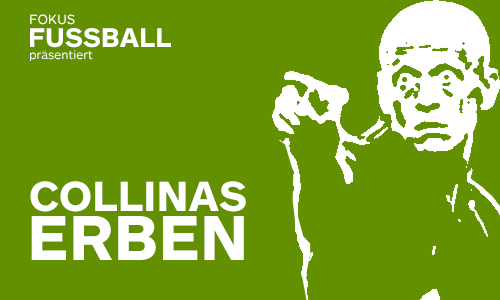Aus, wie man so schön sagt, gegebenem Anlass folgt hier eine kurze Textsonderausgabe von »Collinas Erben« zum DFB-Pokal-Viertelfinale.
1. FSV Mainz 05 – SC Freiburg
Selbst der Mainzer Trainer Thomas Tuchel, der zuletzt vernehmlich über die vermeintliche Benachteiligung seiner Mannschaft durch die Referees gegreint hatte, mochte diesmal nichts Schlechtes über den Schiedsrichter sagen. Dabei hatte Deniz Aytekin mit der Gelb-Roten Karte gegen den Mainzer Zdenek Pospech in der 65. Minute und dem Strafstoß für Freiburg in der Nachspielzeit, der zum späten Ausgleich und damit zur Verlängerung führte, zwei Entscheidungen getroffen, die die Hausherren außerordentlich schmerzten.
Doch der glänzend leitende Unparteiische lag beide Male richtig: Pospech, schon verwarnt, wusste den davonziehenden Daniel Caligiuri nur durch ein unsanftes Tackling an der Seitenlinie zu bremsen; die Gelb-Rote Karte war derart folgerichtig, dass die Mainzer so gut wie gar nicht gegen sie protestierten. Ungleich heftiger fielen die Reklamationen gegen den Strafstoßpfiff kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit aus. Dabei hatte Aytekin auch hier völlig korrekt entschieden, denn Radoslav Zabavnik traf nur Ivan Santinis Beine und sonst gar nichts. Was die TV-Zuschauer erst durch Zeitlupe und Ausschnittvergrößerung erkennen konnten, hatte der Schiedsrichter dank seines vorzüglichen Stellungsspiels und seines geübten Blicks sofort erkannt. Bemerkenswert!
FC Bayern München – Borussia Dortmund
Dass der DFB zu einem solchen Spiel einen Schiedsrichter ansetzt, der zu den bundesweit besten gehört und auch bei den beteiligten Klubs ein Höchstmaß an Akzeptanz besitzt, versteht sich von selbst. Knut Kircher verkörpert diese Eigenschaften ohne jeden Zweifel, wie er auch am Mittwochabend eindrucksvoll unter Beweis stellte. Seine unaufgeregte, souveräne Art der Spielleitung stand in einem erfreulichen Kontrast zu dem Ballyhoo im Vorfeld der Partie. Nicht zuletzt ihm ist es zu verdanken, dass das Pokalspiel zwischen den beiden zurzeit wohl besten deutschen Teams größtenteils sehr anständig blieb. [Das gesamte Match in der ARD-Mediathek: 1. Hälfte | 2. Hälfte]
Dabei hatte Kircher einmal das sprichwörtliche Glück des Tüchtigen auf seiner Seite, nämlich in der 42. Minute, kurz bevor das 1:0 für die Bayern fiel: Marcel Schmelzers Grätsche gegen Philipp Lahm im Strafraum des BVB hätte eigentlich einen Strafstoß zur Folge haben müssen, weil der Dortmunder unzweifelhaft nur die Beine des Bayern-Kapitäns traf. Kircher ließ das Spiel jedoch weiterlaufen, und Arjen Robben erzielte unmittelbar nach dem Foul das Tor des Tages.
Ob der Referee Schmelzers Einsteigen gar nicht als regelwidrig einstufte oder ob er auf Vorteil erkannte, ist beim Betrachten der Fernsehbilder nicht auszumachen, aber gehen wir einmal von Letzterem aus, weil es regeltechnisch interessanter ist. Hätte Robben nicht getroffen, wäre nämlich kein nachträglicher Strafstoßpfiff mehr möglich gewesen. Zwar kann der Schiedsrichter bei einer Vorteilsgewährung prinzipiell das ursprüngliche Vergehen noch ahnden, wenn sich der Vorteil nicht innerhalb von zwei bis drei Sekunden einstellt. Das gilt aber ausdrücklich nicht, wenn ein Spieler nach der Vorteilsentscheidung ungehindert in Ballbesitz gelangt (was bei Robben der Fall war) und den seiner Mannschaft gewährten Vorteil anschließend vergibt.
Aus diesem Grund wird in Situationen, in denen ein Strafstoß fällig ist, vom Schiedsrichter normalerweise nicht auf Vorteil erkannt – schließlich besteht der größere Vorteil fast immer darin, aus elf Metern ungestört und in aller Ruhe aufs Tor schießen zu können. Nun mag man Knut Kircher zugestehen, dass er um Arjen Robbens Schusskünste weiß. Dennoch war seine Entscheidung, darauf zu vertrauen, schon ein wenig heikel.
Wurde über diese Szene nach der Partie kaum gesprochen, so sorgte das rüde Foul von Javier Martínez an Robert Lewandowski in der 62. Minute umso mehr für Diskussionen. Knut Kircher beließ es bei einer Verwarnung, manch anderer dagegen fand hier einen Platzverweis angebracht.
Tatsächlich handelt es sich um einen Grenzfall, bei dem der Schiedsrichter noch einen gewissen Spielraum hatte – weil das Tackling, das auf Lewandowskis Sprunggelenk endete, von der Seite kam und der Ball, als Martínez zur Grätsche ansetzte, zumindest noch in Spielnähe war – und deshalb Faktoren berücksichtigte, die über das Vergehen als solches hinausgingen: Bis zu diesem Zeitpunkt gab es in der Partie kein einziges böses Foul und keine einzige Gelbe Karte; die Atmosphäre auf dem Platz war trotz der Bedeutung des Spiels friedlich, die Zweikämpfe wurden engagiert, aber überwiegend fair geführt. Martínez’ Einsteigen gegen Lewandowski kam da wie aus dem Nichts.
Ein erfahrener Schiedsrichter wie Knut Kircher bedenkt in einer gänzlich unerwarteten Situation wie dieser bei der Abwägung zwischen »Gelb« und »Rot« auch, welche (potenzielle) Wirkung und welche (möglichen) Folgen die persönliche Strafe haben wird: Beginnt er gleich mit einem Feldverweis, der einerseits vertretbar, andererseits aber auch recht hart gewesen wäre und die Gefahr heraufbeschworen hätte, dass die Begegnung schlagartig emotional und ruppig wird? Oder belässt er es bei einer Verwarnung – in Schiedsrichterkreisen würde man sagen: bei »Dunkelgelb« – und damit bei der wegen des bisherigen Spielcharakters eigentlich logische(re)n Sanktion?
Kircher entschied sich für die letztgenannte Option, und wenn man die Partie aus schiedsrichtertaktischer Sicht beurteilt, lag er damit richtig: Von den beiden Ellenbogenvergehen der Bayernspieler Kroos (67. Minute) und Mandžukić (78. Minute) abgesehen – die beide konsequent mit einer Gelben Karte geahndet wurden, wie es die Anweisungen des DFB vorsehen –, blieb das Spiel weiterhin ausgesprochen fair. So manche Entscheidungen des Referees muss man eben auch im Kontext der gesamten Begegnung sehen und beurteilen. Wie gesagt: Hier lag so gerade noch ein Grenzfall vor – was auch bedeutet, dass Martínez’ Foul bei einem anderen Spielverlauf sehr wohl eine Rote Karte hätte nach sich ziehen können.